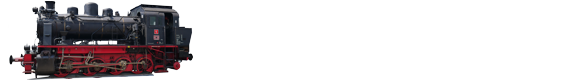Hallo Friedrich,
Ist das Stück denn immer noch in Friedrichstal einsetzbar? Oder passt es dort nun nicht mehr?
mfg
Thomas
Hallo Friedrich,
Ist das Stück denn immer noch in Friedrichstal einsetzbar? Oder passt es dort nun nicht mehr?
mfg
Thomas
Hi Friedrich,
danke für die Antwort!
mfg
Thomas
Alles anzeigen
Hallo Friedrich,
hast du die Kupplung bei dem Wagen festgelegt, oder im Schwenkbereich begrenzt oder unbearbeitet gelassen?
mfg
Thomas
Hi Tim,
ein besnders herzliches Willkommen - und nur zur Info, es gibt eine FREMO-Gruppe im vereinten Königreich, vielleicht kann Pottendorf da ja mal teilnehmen, ohne die britische Insel zu verlassen
Hi Tim,
a very warm welcome for you - and just to mention, there is a FREMO group in UK as well, maybe Pottendorf can join a meeting without leaving Britain ![]()
kind regards
Thomas
Moin,
ich würde für die Einfahrsignale Wattenscheider Signalträger vorsehen. Damit werden sie dann auf passenden Streckenmodulen platziert, die möglichst alle einen Wattenscheider Schacht aufweisen sollten, um bei passendem Einbau in Bezug auf den Bahnhof das Einfahrsignal aufnehmen können.
mfg
Thomas
Moin,
Entweder Ein- oder Zweigleisig... Lass die Weichen weg. Die bringen keinen zusätzlichen Nutzen
Dem kann ich nur beipflichten - und der Einsatz von zweigleisigen Strecken ist nicht auf "Großtreffen" beschränkt, auch Regionaltreffen kleiner Gruppen können je nach Verfügbarkeit entsprechende Strecken aufweisen.
mfg
Thomas
Hallo zusammen,
Martin liegt richtig - natürlich sieht ein Zug in einer überhöhten Kurve toll aus, aber sinnvoll ist das nur in grösseren Modulgruppen, deren Einzelsegmente dann nicht mehr unabhängig verwendet werden können.
Für einzelne Bogenmodule lasst bitte die Überhöhung weg, da ihr nicht wissen könnt, wie die anschliessenden Module sein werden - weitere Bögen? Vielleicht mit anderem Radius? Oder eine Gerade?
mfg
Thomas
Man müsste ja nur einmal den Link anklicken: http://www.rrpicturearchives.net/showPicture.aspx?id=1936471
Warum sollte man, wenn das Vorschaubild etwas anderes als das gesuchte zeigt?
Die Module im FREMO (H0RE) sollen in der Moduldatenbank erfasst werden. Dafür wurden vor vielen Jahren die Module mit einem Namenskürzel und einer fortlaufenden Nummer erfasst, mittlerweile sind die Nummern aus festen Bereichen, die von regionalen Verwaltern zugeteilt werden.
Die BALIMO-Module können über die Nummern eindeutig identifiziert werden - BALI425 ist halt einfacher zu verwalten als "Bruchsteinmauer".
mfg
Thomas
Hi Bruno,
sieht schick aus - willst du es für Cloppenburg anmelden?
mfg
Thomas
Hallo Friedrich,
Am 31. 12. 1965 gab es schon 742 Wagen der Gattung SSylms 710.
Das ist für mich noch Epoche III.
[..]
Für mich ist wichtig das der Wagen eindeutig identifiziert werden kann. Manchmal, aber nicht oft, ist es bei mir dann halt eine Fantasie-Nummer.
Mir ist klar, dass es den Wagentyp in der Epoche 3b bereits existierte - und du hast meinen Respekt für das Zusammenstückeln der Nummer!
Mir waren nur die Überreste der EpIV-Beschriftung aufgefallen, die noch am Wagen vorhanden sind, daher meine Rückfrage.
mfg
Thomas
Hallo Friedrich,
Wenn ich das auf dem Bild richtig erkenne, hast du hier einen Wagen in UIC-Beschriftung mit neuen Epoche III-Nummern versehen und die Prüfziffer weggelassen - kann das sein?
mfg
Thomas
Bei "Zwinge West" kommt mir sofort ein Artikel von Stephan Rieche in Bahn&Modell in den Sinn, in dem er einen solchen, grenzbedingten Endhaltepunkt baut und zeigt und auch einen Anlagenvorschlag mitliefert: Von "Barnstorff" nach "Zwinge West"
Wer nachlesen mag: B&M 12/87, S. 37 ff
mfg
Thomas
Ich habe das Vorbildfoto nun beim Durchblättern eines Buches auch gesehen, schweige aber über den Ort ![]()
mfg
Thomas
Ah, das neue Provinzialstraßenprofil - passt auch für Münster-Rheda..
mfg
Thomas
Moin Andreas,
wenn die Leiterbahnen nur durchtrennt sind, reicht eigentlich ein Stück Draht:
1. Entfernung des (oft grünen) Lötstoplacks mit einem Messer oder Glasfaserradierer (wie von Axel schon erwähnt) 2-3mm beidseitig der Trennung
2. Vorverzinnen der freigelegten Leiterbahn
3. Ein Stück blanken Draht über die Lücke legen und beidseitig verlöten
mfg
Thomas
Moin,
ich habe nur ein Bild in meinem Fundus gefunden:
Man sieht schön die Geometrie, leider ist die Schwenkbühne da nicht ausgefahren.
mfg
Thomas
Hallo Thomas,
Wären es meine Module, dann hätte ich an der linken Seite noch ein "Reserve"-Radienmodul angehängt um auf die 90° zu kommen. Außerdem ein Zwischenmodul um das 50er Raster einzuhalten. Ich könnte mir Vorstellen, dass das dem verantwortlichen Planer besser gefällt.
Dazu kann ich als Planer sagen: eine Modulgruppe, die 45° ergibt, ist mir genauso lieb wie eine, die 90° ergibt - am liebsten jedoch eine, die man durch Weglassen von Teilen im Winkel verändern kann.
Ein Raster, an das sich Modullängen halten sollen, ist mir nicht bekannt, das hängt primär von den Gegebenheiten des Erbauers ab, er muss die Module lagern und transportieren können, in die Halle passen auch 2570mm Modullänge ![]()
mfg
Thomas